Der Elbrus im Kaukasus -
der höchste Berg Europas an der Grenze zu Asien

Der über 1500 km lange Hauptkamm
des Kaukasus zwischen Kaspischem und Schwarzem Meer wird als die geografische
Grenze zwischen Europa und Asien gesehen. In vielen Teilen ist diese Grenze
auch die politische Grenze zwischen den beiden Erdteilen (Rußland -
Georgien).
Einige deutsche Lexika haben nun einen
Grenzverlauf durch die Manytsch-Niederung - irgendeine völlig unbestimmbare
gekurvte Strecke durch eine riesige Ebene als Grenze bestimmt. Damit stehen
sie relativ allein da, weil weltweit (auch in anderen Lexika) der Kaukasuskamm
als Grenze betrachtet wird. Ich habe dies mal bei Bertelsmann nachgefragt
und sie haben tatsächlich geantwortet:
Nunja, die Geografen, mit denen ich gesprochen
habe, betrachten ebenso den Hauptkamm des Gebirges als Grenze, aber da steite
ich mich nicht mehr mit Bertelsmann herum. Meiner
Ansicht nach hält sich die Fehlinformation (Mont Blanc als höchster
Berg) hauptsächlich aus touristisch/kommerziellen Gründen Frankreichs,
die einen Haufen Geld verlieren würden, wenn der Streit darum endlich
geschlichtet werden würde - höchstwahrscheinlichkeit zu deren Nachteil.
Unter den Bergsteigern und dem Rest der
Welt gilt der Elbrus mit 5642 m als der höchste Berg Europas, einer der
"Seven Summits" ... (Zum Vergleich: der Mont Blanc als höchster
Berg der Alpen ist nur 4808 m hoch).

Die Seven Summits sind die jeweils höchsten Berge eines Kontinentes:
|
Fast 1000 Meter höher als die ihn
umgebenden Berge dominiert der Elbrus mit einem vergletscherten Doppelgipfel
die Landschaft des zentralen Kaukasus. Die beiden Gipfel entstammen unterschiedlichen
Vulkanausbrüchen. Der höhere Westgipfel ist älter; der jüngere
Ostgipfel mit einem Krater von 250 m Durchmesser weist noch Spuren kürzlicher
Vulkanaktivität auf. Die schwache Ausgasung des Vulkans trägt noch
zusätzlich zur Verschlechterung der Atemluft bei.
Der gesamte Berg ist mit etwa 145 Quadratkilometern
Gletschern übersät, die an einigen Stellen 400 m dick sind. Vom
Sattel, der die beiden Gipfel voneinander trennt, erstrecken sich die Hänge
(relativ) mäßig hinunter und die Eiszungen enden in vielen wunderschönen
Tälern. Die Gletscher sind durch ihre ständige Bewegung sehr verspaltet.
Am Westhang befindet sich eine Art Turm,
Kiukiurtliu. Die vertikalen Seiten des Monolithen sind an der südlichen
und westlichen Seite mit einem Besteigungsgrad von 5 und 6 ausgewiesen.
Die Höhe, der Luftmangel, die Kälte,
der starkte Wind, das sich extrem schnell ändernde Wetter und die freie
Lage des Berges erschweren den Aufstieg. Der Berg besitzt aufgrund seiner
Lage - freistehend, ungeschützt und 1 km höher als die ihn umgebenden
Berge - sein eigenes unberechenbares Mikroklima. Dies alles hielt Bergsteiger
Jahrhunderte davon ab, den Gipfel zu erklimmen. Die Erstbesteigung fand 1874
statt (A. W. Moore, F. Gardiner, F. Cruford Grove, Horace Walker, Pete Knubel).
| Die besten Monate für
die Besteigung sind Juli und August. Juni und September können auch
einige gute Wetterfenster bieten. Die Normalroute ist ein langer mäßiger Aufstieg, ab ca. 3700 m über Gletscher. Es sind kaum technische Schwierigkeiten vorhanden, wenn man nicht von der Route abweicht. Zu beiden Seiten erstrecken sich riesige Gletscherspalten. So einfach die Route auch erscheint, ist dafür die Todesrate recht hoch. Allein im Jahr 2004 waren es bis ca. August 34 Fälle. Die Geschichte des Berges ist gespickt mit dem Tod von Gruppen, die entweder beim Abstieg verlorengegangen waren oder in großer Höhe von schlechtem Wetter überrascht wurden. Das Wetter kann von einem Augenblick zum anderen ohne Vorwarnung wechseln und es ist leicht, sich in den ausgedehnten und verspalteten Gletscherfeldern zu verlieren.Die Route startet in Azau, wo sich der Pfad unter den Liften entlangschlängelt. Die Lifte (zwei Seilbahnen und ein Sessellift) sind stark von Touristen der nördlich liegenden Kurorte frequentiert. Sie können auch eine Hilfe bei der notwendigen Akklimatisation darstellen. Der Sessellift fährt bis zu den Fässern (Kara-Bashi oder englisch: Barrels) auf 3700m. Mit Steigeisen geht es weiter bis zur Priuthütte, wo man sich einquartieren kann. Auch findet sich dort ein geschützter Zeltplatz in den Ruinen der im August 1998 abgebrannten alten Hütte. Von dort aus ist die Strecke bis etwa 5100 m einsehbar. Durch eine Art "Autobahn" (von uns so getaufte Teilstrecke) gelangt man zu den Pastuchov-Felsen, die sich bis auf 4800 m erstrecken. Von dort geht es weiter bis auf etwa 5000 m, wo es in einer scharfen Linkskurve 400 lange Höhenmeter über die Traverse bis zum Sattel geht. Aufgrund der Höhe kann die Strecke sehr anstrengend sein. Die Aussicht ist jedoch großartig. |
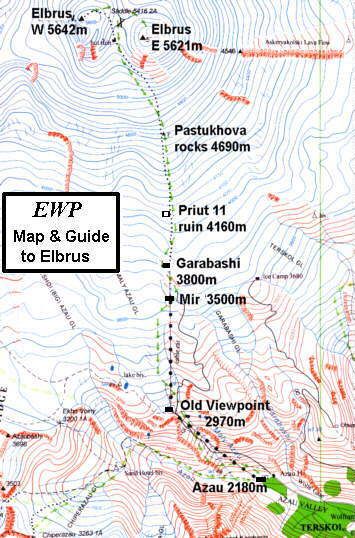 |
| Auf dem Sattel befinden
sich die Ruinen einer alten Hütte. Nur noch die Dachkonstruktion
schaut aus dem Schnee hervor. Der Weg teilt sich hier - einmal zum Ost-
und einmal zum Westgipfel. Der Aufstieg wird steiler und der Schnee ist
stark vereist (verharscht). Die restlichen 250 m zum Westgipfel erscheinen
recht lang. Die durchschnittliche Dauer des Aufstieges liegen bei 8-10 Stunden und man rechnet für den Abstieg weitere 4 Stunden hinzu. Notwendige Ausrüstungsgegenstände sind Steigeisen und Teleskopstöcke (wetterbedingt GPS). Zum GPS ist noch zu erwähnen, daß der Besitz desselben zwar legitim ist, aber die Benutzung offiziell verboten (Grenzgebiet!) - zumindest im Jahr 2001. Keiner schert sich jedoch darum - selbst die angetroffenen Soldaten nicht - und die Koordinaten für den Aufstieg kann man im Internet finden. Aufgrund der schnellen Wetterumschwünge ist die Benutzung sicherheitshalber anzuraten. Update (2003): Inzwischen ist die Benutzung von GPS kein Problem mehr, aber da es immer noch Grenzgebiet ist (streng militärisch überwacht), sind Funkgeräte u. ä. verboten. Ende Frühling/Anfang Sommer wird der Elbrus sehr gern als Skigebiet genutzt. |
|